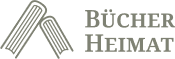Buchstaben im Kopf
Max Mahler
Ens Reale
Etwas ist da. Ich spüre es. Ich merke, wie sich mein Herz beschleunigt, die Nackenhaare aufstellen und ich losrennen möchte. Und dennoch, ohne jegliche Kontrolle über meinen Körper, gehe ich ganz ruhig weiter. Durch menschenleere Straßen, die ich nicht erkenne, in einer Stadt, die mir fremd ist. Die Häuser sind nur noch Ruinen, jegliche anthropogene Vegetation scheint schon lange nicht mehr zu existieren und stattdessen hatte sich die Natur den Ort wieder zu eigen gemacht. In einer Fremde, die ich nicht zu erklären vermag. Der Himmel über mir ist nicht zu erkennen; Wolken, so undurchdringlich grau, ließen mich an der Existenz einer Sonne zweifeln. Selbst bei Windstille spürte ich normalerweise noch den Widerstand der Luft. Nichts wünsche ich mir sehnlicher als zurückgehalten zu werden; ich wollte nicht weiter. Und doch wandelten meine Füße weiter die Straßen entlang, umgeben vom Nichts und getrieben von etwas Fremdem. Das Gefühl zu wissen, dass da was ist und dennoch nichts zu sehen, schien meinen Körper in Trance versetzt zu haben. Irgendwann verließ ich die Stadt mit meiner Angst als ständigen Begleiter. Ein alter rauer Landweg wechselt das Gefühl unter meinen Füßen. Felder und in weiter Ferne grüne Wälder kommen in mein Sichtfeld. Ein Anblick gleichsam beruhigend als auch eine neue Angst erweckend. Den Wald, das Ungewisse als Ziel, steuern meine Füße auf ihn zu. Meine Ohren klingeln und um mich herum vibriert die Luft. „Weiter, weiter. Immer weiter.“ Scheint das Nichts um mich herum zu flüstern. Doch ich kann niemanden sehen. „Im Wald, der Stamm.“ Irgendwann stehe ich auf einmal mitten im Wald. Der Wald schien mich vollkommen absorbiert zu haben. Gefangen im Körper, sehe ich mich nach Kontrolle. Trotzdem hält mich die Trance weiterhin davon ab, mich umzudrehen und loszurennen. Um mich herum recken meterhohe Bäume, uralt und gottgleich, sich dem Himmel entgegen. Die Kronen bilden ihren eigenen Himmel aus Ästen und Blättern; stoisch und sanft liegt der Waldboden zu meinen Füßen. Wurzeln schlängeln sich über den Boden und durch sie hindurch recken sich neue Sprösslinge. Unendlich weit erstreckt sich dieser Anblick und erschafft ein Bild von Unendlichkeit. Immer weiter und weiter, immer tiefer und tiefer. Auf einmal stehe ich vor einem massiven Baumstumpf. Er scheint schon lange tot zu sein und schwarz-grünliche Fäulnis kriecht über ihn. Dieses Bild wirkt so surreal in diesem ansonsten lebendigen Wald. Es ist, als fließe der Tod um ihn herum oder zu ihm hin. Ich möchte mich losreißen, in eine Kugel zusammenrollen. Und dennoch kann ich nicht mal meinen Blick von dem abwenden, was dort auf dem Baumstamm ruht. Auf dem Baumstamm sitzt ein Wesen aus schwarzen Gebeinen. Wenn es mal was Weltliches an sich hatte, dann ist das lange her und nun unendlich entstellt. Zusammengekauert, in seiner Haltung, sitzt es wie auf seinem Thron. Die Knochen sind stellenweise spitz zulaufend, wie die Dornen. Das, was vermutlich mal Finger waren, gleicht inzwischen an beiden Händen Krallen. Lang und spitz zulaufend, mit einer rauen Oberfläche, ruhen sie in seinem Schoß. Der Ober- und Unterarm und die Füße sind durchstoßen von schwarzen Dornen. Es wirkt, wie als würde der Wald es festhalten. In seiner Position wirkt es fast friedlich, beinah schlafend. Und doch hat der Wald, die Natur, dieses Wesen für sich in Anspruch genommen. Oder ist es ein Teil von ihr? Die Blätter wiegen sich leicht im Wind, sicher ihrer Souveränität über alles Lebende. Was war das, so ruhig auf dem Stamm ruhende Ding? War es mal lebendig? Hat es sich dort hingesetzt und ist nie wieder aufgestanden. Mich beschleicht jedoch die Vermutung, dass es schon immer dort war, wo es jetzt saß. Als der Wald erblühte, erblühte auch es und wenn er irgendwann verschwindet, wird auch es mit ihm verwinden. Ein Repräsentant. Nicht einst menschlich, sondern dem Menschen als Bildnis. Ein Gegenüber. Zum Kontakt für uns mit ihr. Hat es sich bewegt? Nein, das kann nicht sein. Wie sollte es? „Deine Art ist schon lange von dieser Welt verschwunden.“ Diese Stimme, woher kommt sie? Sie dröhnt in meinen Kopf und durch meinen ganzen Körper. Langsam, ganz langsam hebt sich der Kopf der auf dem Stamm sitzenden Figur. „Lange schon hatte keiner eurer Art sich über diesen Boden bewegt. Ich konnte ruhen, heilen. Meine Kräfte wieder sammeln“ Knarrend, einem gebrochenen Ast ähnlich, richtet es sich auf, ohne jedoch, dass die Pflanzen, welche ihn umschlungen, sich gestört zu fühlen schienen. „Erschrecke nicht, für dich wird es bald nichts weiter als ein Traum sein, eine Warnung. Und doch, was du siehst, ist die wahrscheinlichste Zukunft für dich und deine Art“ Ich versuche mich aus meiner Starre zu lösen. „Nein, nicht sprechen, nur zuhören“, flüstert es. Irgendwie spüre ich keine Gefahr mehr und auch keine Angst, sondern nur noch eine Traurigkeit und eine Schwere, welche die Luft zu erfüllen scheint. „Du magst vielleicht grade noch verwirrt, vielleicht sogar verängstigt sein, doch sei unbesorgt. Der Mensch weiß so viel und doch verschließt er sich lieber davor. Nicht aus Angst, nein, ihr versteckt euch nicht vor der eigentlichen Tatsache, sondern vor dem Umstand, dass es Wandel bedeuten könnte. Ihr seid paradoxe Wesen.“ Immer weiter erhebt es sich. Gestützt auf seinen knochigen Armen ruht es kurz noch auf dem Baumstamm. „Die Menschheit wird ihr eigener Ruin werden. Wann genau es passieren kann, kann ich dir nicht sagen. Zeit, wie ihr es nennt, existiert für mich nicht so wie für euch. Ihr nennt es Tage, Monate, Jahre. Aber für mich sind es Zyklen. Ihr habt mich vor langer Zeit zugrunde gerichtet. Wofür? Eure eigene Habsucht. Ihr wolltet mehr, immer mehr. Manche von euch werden versuchen, was zu ändern und zu scheitern, wegen der Gierigen und Ignoranten. Dieses Spiel wird sich immer und immer wieder wiederholen, bis keiner mehr da ist, der es spielen kann. Wie hieß nochmal eure Lebensweisheit? Der größte Feind des Menschen ist er selbst. Ich existiere schon seit Milliarden von Jahren, ich sah Arten aufgrund äußerer Umstände aussterben. Doch ihr …“ Seine knochige Hand hebt sich langsam und zeigt mit seinem knochigen Finger auf mich. „... ihr wart die erste Art, die sich selbst an den Abgrund gestellt und rückwärts hat fallen lassen. Ihr wart zu großen fähig, doch habt ihr euch lieber selbst bekämpft. Ihr habt immer neue Möglichkeiten gefunden, euch gegenseitig zu schaden, versklaven und zu töten. Einen so großen Hang zur Zerstörung und Leid hatte kein anderes Tier neben euch. Dennoch habt ihr euch über alles Leben gestellt“ Sein knochiger Finger senkt sich wieder und so bleibt er jetzt stehen. Die Blätter und Pflanzen wiegen jetzt nicht mehr im Winde, sondern stehen ganz still, wie als warteten sie darauf, dass es weitersprach. Jedoch drehte es sich von mir weg und ging um den Baumstamm herum tiefer in den Wald. Ich folge ihm wie hypnotisiert von seinen Worten. Für längere Zeit sagt er nichts. Die Tiere des Waldes um uns herum fühlten sich nicht im Geringsten von unserer Anwesenheit gestört; es schien, als wären wir nicht da. Je tiefer wir in den Wald gingen, umso mehr fühlte es sich an, als würden wir mit dem Wald verschmelzen. Da gingen wir scheinbar ohne Ziel, doch auf einmal kam ein kleiner Bach in Sicht. Ich hielt ein paar Meter vor dem Bach, welcher eher einem Rinnsal glich. Es ging noch ein paar Schritte auf ihn zu. „Keine Sorge, du wirst schon bald wieder zu Hause sein.“ Ich erschrak, ich hatte schon fast den Klang seiner Stimme vergessen. „Wasser, ihr könnt nicht ohne es, es spielte bei euch schon immer eine übergeordnete Rolle. Ihr habt es in Besitz genommen, deklariert, dass es eures sei. Dennoch ist es noch da und ihr nicht, ebenso der Wald, in dem wir stehen. Hier, wo wir stehen, fing damals erst der Wald an. Ihr hattet ihn gerodet und der Rest war krank.“ Er dreht sich wieder mir zu. „Millionen von Jahren wird es dauern, bis ich mich wieder erholt habe. Millionen. Weil ich euch und eurem ‚Fortschritt‘ ausgesetzt war.“ Es geht langsam auf mich zu, mustert mich kurz, legt seine Hand über meine Augen. Ich erwartete, dass sie sich kalt und rau anfühlen würde, doch sie ist weder kalt noch warm und weder rau noch glatt. Plötzlich kann ich wieder fühlen, meinen Körper, die Umgebung, den Boden unter meinen Füßen. Es scheint, als würde ich wieder Kraft über meinen Körper bekommen. Eine kühle Brise weht um mich herum und die Luft riecht wie nach einem Regenschauer. Ich stehe in einer steinigen Landschaft, in weiterer Ferne erkenne ich einen Berg. In ein kaltes Blau grau getaucht erhebt er sich. Die Landschaft wird nur ab und zu durch kleine Pfützen Wasser unterbrochen. Der Himmel ist in ein kaltes, helles Blau getaucht und verleiht ihm eine unendliche Weite. Einige Meter vor mir sehe ich einen schwarz zerrissenen Umhang im Wind wehen. Als ich einen Schritt auf ihn zumachen, dreht er sich um und ich stehe wieder Auge um Auge mit ihm. „Das wird unser letzter Stopp sein.“ Es hebt seine Arme und spricht mit trauriger Stimme weiter „... das hier war einst ein Meer, unendlich weit und wild. Mit einem warmen Himmel und gemütlich trägen Wellen bis zum Horizont." Sein neugewonnener Umhang weht im Wind und verlieh ihm ein trauriges Aussehen. „Wo bin ich hier?“, meine ersten Worte, die ich an es richte. Sie stehen symbolisch für alles, was mir die letzten Minuten durch den Kopf gingen. Waren es überhaupt Minuten? Waren es vielleicht sogar Stunden? Oder doch nur Momente, nicht mehr als der flüchtige Flügelschlag eines Schmetterlings. „Könnte es sein, dass du immer noch nicht verstehst?“ Diese Worte kommen nicht wie ein Lehrer, der seinen Schüler belehrt; sie klingen eher traurig. „Was verstehen …“, sag’ ich langsam, überrascht von der Gefasstheit und Angriffslustigkeit meiner eigenen Stimme. „… , dass ich träume und ich gleich aufwachen werde. Nicht mehr als eine vage Erinnerung hieran haben werde.“ Das knochige Gebiss des Wesens verzog sich leicht. War das ein mitleidiges Lächeln? „Warum glaubst du, bist du hier?“, fragt es. „Ich glaube nicht, dass es irgendeine eine Bedeutung hat. Ich bin hier, weil ich träume!“, antworte ich. „Meine Worte zu verstehen, kann ich dir nicht abnehmen, das ist deine Aufgabe. Doch lass mich dir das noch mitgeben, die Natur des Menschen, eure Natur, ist nicht nur von Neid und Gier geprägt.“ Damit wandte es sich um und ging in Richtung des Berges; immer weiter ging es. Die Luft schien zu vibrieren und eine Gänsehaut lief mir über Rücken und Arme. Ich schaue auf meine Hände hinab und sehe, dass sie leicht zittern. Dann blicke ich wieder auf und sehe nichts mehr vor mir als die weite kalte Landschaft und einen einsamen Umhang, der vom Wind davon getragen wird. Ich erwache in meinem Zimmer. Ein warmer Luftzug zieht durch das geöffnete Fenster. Ich setze mich auf und schaue aus dem Fenster, draußen scheint schon die Sonne. Die Blätter der Bäume wiegen sich sanft im Wind und ich bleibe wie gebannt sitzen. Wartend darauf, dass die Welt sich wieder dreht.